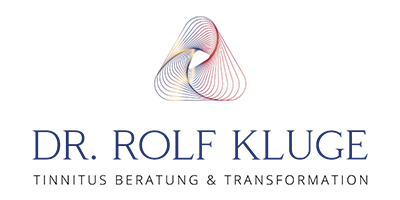Am 7. Dezember 2024 fand das jährliche Tinnitussymposium an der renommierten Charité in Berlin statt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professorin Dr. Birgit Mazurek wurde den Teilnehmenden ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm geboten, das sowohl Fachpublikum als auch Betroffene gleichermaßen begeisterte. Neben spannenden Vorträgen stand vor allem der Austausch zwischen den Teilnehmenden im Mittelpunkt.
Einblicke in die Entstehungsmodelle von Tinnitus
Zu Beginn des Symposiums wurde die Vielfalt der Entstehungsmodelle von Tinnitus thematisiert. Verschiedene Referent:innen beleuchteten, wie Stress, neurologische Veränderungen und akustische Überlastung zur Entstehung von Tinnitus beitragen können. Dabei wurden sowohl klassische als auch innovative Ansätze vorgestellt. Prof. Mazurek betonte, wie wichtig es sei, Tinnitus nicht isoliert, sondern im Kontext seiner vielfältigen Wechselwirkungen zu betrachten.
Die Bedeutung der Komorbiditäten wurde besonders hervorgehoben. Depressionen, Ängste und chronischer Stress sind häufige Begleiter von Tinnitus und können dessen Verlauf erheblich beeinflussen. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass eine interdisziplinäre Herangehensweise erforderlich ist, um Betroffene umfassend zu unterstützen.
Neueste Erkenntnisse zu Komorbiditäten und Lärm
Ein zentraler Schwerpunkt des Symposiums lag auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Auswirkungen von Lärm auf das Gehör und die Entstehung von Tinnitus. Studien zeigen, dass Lärmbelastung nicht nur das Risiko für Schwerhörigkeit erhöht, sondern auch die Tinnitus-Wahrnehmung verstärken kann. In einem Vortrag wurde darauf hingewiesen, dass präventive Maßnahmen, wie das Tragen von Gehörschutz, essenziell sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Ein weiterer Aspekt war der Einfluss psychosozialer Faktoren. Isolation, fehlende Unterstützung und die gesellschaftliche Stigmatisierung von Hörproblemen können die Belastung durch Tinnitus zusätzlich verstärken. Expert:innen stellten Strategien vor, um Betroffene besser in ihren sozialen Kontext zu integrieren und ihre Lebensqualität zu verbessern.
Neurobiologische Aspekte und neue Therapieansätze
Die neurobiologischen Grundlagen von Tinnitus standen ebenfalls im Fokus. Prof. Dr. van Dijk von der Universität Groningen, der später den Stiftungspreis erhielt, präsentierte seine Forschungsergebnisse zum Einfluss des Neurotransmitters GABA. Seine Arbeit zeigte, wie gezielte Eingriffe in neurobiologische Prozesse zur Linderung von Tinnitus beitragen können. Diese Erkenntnisse wurden als bahnbrechend bezeichnet und könnten künftige Therapieansätze revolutionieren.
Neben medikamentösen Ansätzen wurden auch manualtherapeutische Methoden vorgestellt, die als begleitende Maßnahmen zur Behandlung von Tinnitus dienen. Physiotherapeut:innen demonstrierten Techniken, die auf die Entspannung der Kiefer- und Nackenmuskulatur abzielen, um die Symptome zu lindern. Solche Ansätze betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung von Tinnitus.
Psychosoziale und interdisziplinäre Perspektiven
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Diskussion um psychosoziale Aspekte. Betroffene berichteten über die Herausforderungen im Alltag, die mit der Krankheit einhergehen, und erhielten wertvolle Tipps von Fachleuten. Dabei wurde deutlich, dass Tinnitus weit über ein medizinisches Problem hinausgeht und umfassende Unterstützung erfordert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen HNO-Ärzt:innen, Psycholog:innen und Neurolog:innen wurde als Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung hervorgehoben.
Der Stiftungspreis als Höhepunkt
Ein besonderer Moment war die Verleihung des 6. Stiftungspreises der Stiftung Tinnitus und Hören der Charité. Prof. Dr. van Dijk wurde für seine herausragenden Forschungsarbeiten ausgezeichnet. In seinem Vortrag legte er dar, wie GABA, ein hemmender Neurotransmitter im Gehirn, die neuronale Aktivität bei Tinnitus beeinflusst. Seine Ergebnisse stießen auf großes Interesse und boten vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Therapien.
Fazit: Fortschritte und Hoffnung
Das Tinnitussymposium 2024 war nicht nur ein wissenschaftlicher Erfolg, sondern auch eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen Fachleuten und Betroffenen. Die Präsentation neuer Forschungsergebnisse und innovativer Ansätze lieferte wesentliche Impulse, um das komplexe Krankheitsbild des Tinnitus besser zu verstehen und effektive Behandlungsstrategien zu entwickeln. Besonders die Verbindung von neurobiologischen Erkenntnissen mit psychosozialen Ansätzen zeigte, dass es Hoffnung für Betroffene gibt. Der Ausblick auf zukünftige Forschungsprojekte macht deutlich: Der interdisziplinäre Austausch bleibt ein unverzichtbarer Motor für Fortschritte in der Tinnitusforschung.